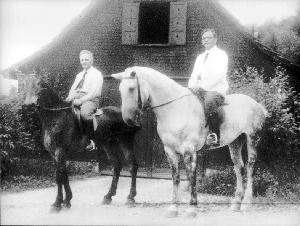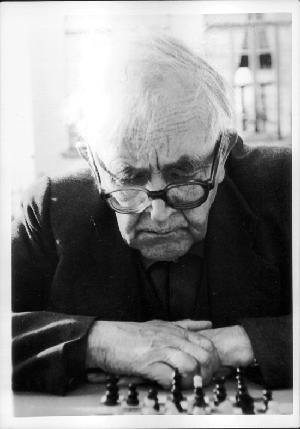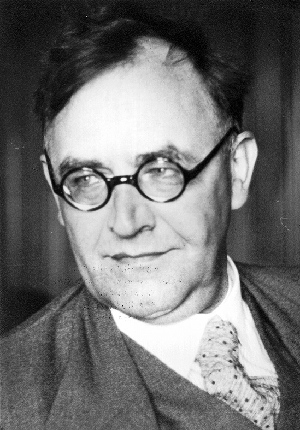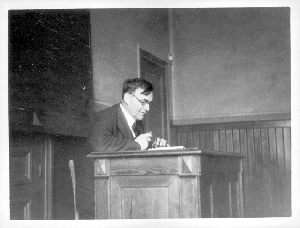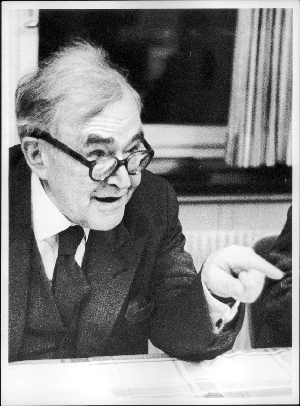Archiv mit Karl Barth durchs Jahr
«Der Barthianismus interessiert mich nicht»
Ich habe ein Buch zu einem Motiv der Theologie Karl Barths geschrieben. Seither nennt mensch mich Barthianer. Ich mag das nicht. Einerseits weil meine Generation von Theologinnen und Theologen nicht mehr so stark in theologischen Schulen denkt, andererseits weil diesem Etikett ein fauler apologetischer Nachgeschmack anhaftet, nämlich frei von jeglicher Kritik am wohl bedeutendsten Theologen des 20. Jahrhunderts und seiner Theologie zu sein. Was die Theologie Barths auszeichnet, ist nicht nur der Mut zu sagen, was Sache ist, sondern vor allem auch eine tiefe Abscheu vor Apologie. Dementsprechend bekannte Barth schon früh in seinem Schaffen: «Wer als Sockel seiner Dogmatik eine Apologetik aufrichtet, der macht und beweist […], dass die Inhalte seiner eigentlichen Dogmatik wenn auch nicht im Einzelnen, so doch als Ganzes der Rechtfertigung vor einem anderswie begründeten Denken fähig und bedürftig seien.» (Unterricht in der christlichen Religion I, 161.) Und als Barth 1963 nach seiner Emeritierung in einem Gespräch auf das Phänomen des «Barthianismus» angesprochen wurde, wollte er dieses «Gespenst» ein für allemal aus der Welt schaffen und gab ziemlich schroff zu Protokoll: «Ich habe nie verlangt, dass mir jemand nachplappern sollte. Es dreht sich nicht um mich, sondern um die Wahrheit – die Wahrheit in der Liebe. Der ‹Barthianismus› interessiert mich nicht.» (Gespräche 1963, 29.) Wer sich heute sodann als Barthianer_in bezeichnet, sollte sich gut überlegen, ob er oder sie sich damit nicht gerade als Anti-Barthianer_in entpuppt.
Matthias Käser
Ewigkeitssonntag
Kürzlich im Pfarrbüro: eine Gruppe Angehöriger sitzt mit vor der Brust verschränkten Armen und grimmigen Minen vor mir. Von Trauer über die alte Mutter ist kaum etwas spürbar. Nur Abwehr: Abwehr gegen dieses ganze Zeremoniell, gegen Kirche, gegen mich als Pfarrperson.
Warum, so wage ich zu fragen, denn überhaupt eine christlich begleitete Trauerfeier erwünscht sei, wenn von Gott nicht die Rede sein soll? Die Antwort: das wenigsten hätte die Mutter doch zugut von der Kirche, wo sie doch ihr ganzes Leben lang Kirchensteuer gezahlt hätte.
Ich bin angefochten von dem, was mir da entgegenkommt, das kann ich nicht leugnen, bleibe aber zugewandt - mit Barth im Hinterkopf, der es dem Höchsten überlässt: „Es ist einem Christen aber erlaubt und geboten … unverzagt zu hoffen, d.h. … unbedingt damit zu rechnen, dass derselbe Heilige Geist, der unbegreiflicherweise mächtig genug war sein, des Christen eigenes finsteres Herz zu erleuchten, mit jenen anderen samt und sonders eines Tages vielleicht noch geringere Mühe als mit ihm haben möchte. Und weiter: unbedingt und nun entscheidend damit zu rechnen, dass der Tag des Kommens Christi … ganz bestimmt der Tag sein wird, da – nicht er, der Christ, aber der, den er als Christ erwartet, auch alle die anderen zu erreichen wissen wird, dass sie... seine Stimme hören werden.“
Melanie Pollmeier
Einem Kartographen ähnlich zeichnet Karl Bart in der sechsten Vorlesung der ‹Einführung in die evangelische Theologie› eine von vier Grundkoordinaten theologischer Existenz nach. Für ihn ist ‹Verwunderung› Voraussetzung und Merkmal theologischen Denkens und sie ist dem philosophisch-sokratischen ‹thaumazein – staunen, sich wundern› vergleichbar. Sie prägt den Menschen, der sich auf die Suche begibt und der theologisch ‹die Segel gesetzt› hat.
Weil es in der Theologie und im Glauben um das Hören auf das Unerwartete (Gottes Wort) geht, ist jede Form der Besserwisserei und des Déjà-Vu im Erkenntnisprozess hinderlich. Weil Gott und die Rede von ihm kein ‹Hausutensil› ist (z.B. eine Art Büchsenöffner), sondern etwas Befremdliches und Unzähmbares, bleibt theologische Existenz der Verwunderung wie dem Wetter auf hoher See bleibend ausgesetzt.
Wo ein Mensch, eine Gemeinde bzw. Kirche aufhört sich zu wundern, hat er oder sie den heiligen Geist zur ‹Zimmerlinde› (Kurt Marti) gemacht und sich allzu wohnlich in der eigenen Stube eingerichtet. Hier wird es – Gott sei Dank, würde Karl Barth sagen – bald zu eng. Man kann ja nicht leben ohne Frischluft und auch nicht segeln bei Windstille. Daran erinnert mich das Karl-Barth-Jubiläum bei meiner Arbeit in der Gemeinde auch ohne Blick aufs Meer.
Pascale Rondez
Die Krux der Reformation
«Unsere evangelische Kirche hat es in den vierhundert Jahren ihres bisherigen Bestandes zu keiner Zeit gänzlich unterlassen können, der Reformation des 16. Jahrhunderts zu gedenken, ihr geschichtliches Bild aufs neue hervorzurufen […], ihre eigene sachliche Verbundenheit mit ihr zu betonen und zu pflegen, sich selbst als Kirche eben jener Reformation zu verstehen wollen.» (K. Barth, Reformation als Entscheidung, 1933, 71) Auch nach 500 Jahren des eigenen Bestehens kann es die evangelische Kirche nicht unterlassen, die Reformation in die Gegenwart zu übersetzen (#Wurstessen), ihr geschichtliches Bild neu hervorzurufen (wandernde Zwinglis) und die sachliche Verbundenheit zu betonen. Wobei gerade letzteres einlädt zu fragen: Was verbindet eigentlich? Sola scriptura? Oder doch eher VerBUNDenheit durch bundestheologisches Gedankengut? Die eigentliche Krux der Reformation ist doch viel mehr, dass sie zwar erinnert, nicht aber 1:1 in unsere Zeit übersetzt werden kann – auch nicht mit Barth. Dafür sola gratia!
Ariane Albisser
Barth, Rom und Maria
Karl Barth hatte keine Berührungsängste gegenüber Rom. In einer seiner Safenwiler Predigten sagte er am Reformationssonntag 1911, die Glocken in einem katholischen Nachbardorf seien ein Zeichen dafür, dass Gott auch dort gesucht und gefunden werde. Nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs im Sommer 1914 nannte er das Gebet für den Weltfrieden Papst Pius X. einen «Lichtpunkt». Es war für ihn selbstverständlich, Werke katholischer Autoren exakt zu lesen und zu verarbeiten, was allerdings nicht ausschliesst, dass er äusserst kritische Fragen an den römischen Katholizismus stellte. Gegenüber Hans Küng nannte er die katholische Mariologie ein «morsches Gebilde, schon im Ansatz» zum Absterben verurteilt. Eine ökumenisch offene Grundhaltung überwiegt trotzdem bis zuletzt: An Mariä Empfängnis, dem 8. Dezember 1968 – zwei Tage vor seinem Tod –, hörte er eine katholische Radiopredigt. Dem Prediger schrieb er (vielleicht in seinem letzten Brief), man habe die Frage der Mariologie theologisch noch nicht aufgearbeitet und man müsse sie auch evangelischerseits neu durchdenken.
Frank Jehle
Streiten für die Kirche Jesu Christi
Karl Barth war kein prinzipieller Pazifist. Zwar lehnte er 1914 den Krieg grundsätzlich ab und bezog nach 1945 gegen die Hoch- und Atomrüstung Stellung, doch war er spätestens 1938 von der Notwendigkeit des Krieges gegen das nationalsozialistische Deutschland überzeugt.
Im September 1938 schien der Ausbruch des Krieges erstmals unvermeidlich. Die Nationalsozialisten forderten den Anschluss der mehrheitlich deutsch besiedelten Randgebiete der mit England und Frankreich verbündeten Tschechoslowakei an das Deutsche Reich. Das «Münchner Abkommen» vom 30.09.1938 zwang die Tschechen, diese Gebiete gegen Garantien für den Bestand des übrigen Staates an Deutschland abzutreten. Der «Frieden» schien gerettet; in Wirklichkeit nutzte Deutschland den Aufschub nur, um weiter massiv zu rüsten, und marschierte sechs Monate später auch in die sogenannte «Rest-Tschechei» ein.
Auf dem Höhepunkt der Krise schrieb Barth an den Prager Theologen Josef L. Hromádka. Wissend um «die unendliche Last und Not», die ein Krieg unvermeidlich bedeuten würde, führte er aus: «Dennoch wage ich es zu hoffen, dass die Söhne der alten Hussiten dem überweich gewordenen Europa dann zeigen werden, dass es auch heute noch Männer gibt. Jeder tschechische Soldat, der dann streitet und leidet, wird es auch für uns – und, ich sage es heute ohne Vorbehalt: er wird es auch für die Kirche Jesu Christi tun, die in dem Dunstkreis der Hitler und Mussolini nur entweder der Lächerlichkeit oder der Ausrottung verfallen kann.»
Selbst von Barths engen deutschen Freunden aus der Bekennenden Kirche wandten sich nach der Veröffentlichung dieses Schreibens einige offen oder stillschweigend von ihm ab.
Peter Zocher
Berufung, Beruf und Arbeit
Dem als «roter Pfarrer von Safenwil» bekannten Karl Barth, der seit dem 23. Januar 1915 Mitglied der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz war und sich an der Seite der Arbeiter gegen die lokale Arbeitgeberschaft engagierte, kann nicht abgesprochen werden, dass er ein ausgeprägtes Bewusstsein für die Arbeitsbedingungen seiner Zeit hatte. Doch es geht nicht nur um ein säkulares und gesellschaftliches Anliegen, auf das der Theologe und Pfarrer reagiert. Durch die Krise in der Arbeitswelt tritt ein zentraler Aspekt des Menschseins zutage.
1951, im vierten Teil der Lehre von der Schöpfung (§§ 55.3 und 56.2), wird die Arbeit, die aktive Betätigung des Menschen in seiner Existenz und im Rahmen seiner persönlichen Grenzen – seiner Kultur, seiner Epoche, seinen Gaben und Fähigkeiten – unter der Bezeichnung Beruf theologisch abgehandelt.
1959, im vorletzten offiziellen Band seiner Dogmatik (vgl. § 71), wird die Vocatio, die Berufung, von ihrer Wichtigkeit her auf dieselbe Ebene gestellt wie die Rechtfertigung und die Heiligung. Die Berufung bezeichnet diese Bedingung der menschlichen Existenz im Angesicht Gottes: Gott ruft den Menschen (Berufung) und der Mensch existiert in seiner Antwort darauf (Beruf).
Der Beruf umfasst mehr als Arbeit im Sinne von Anstellung oder Beschäftigung. Doch diese gehören auch mit dazu und bestimmen weitgehend dessen Wahrnehmung. Die theologische Ernsthaftigkeit, mit der Karl Barth sich mit dem Begriff der Arbeit auseinandersetzt, sollte auch uns dazu bewegen, klare und deutliche Worte zur heutigen Situation im Erwerbsleben zu äussern; über das Entfremdende, das es hat, doch vor allem auch über den verborgenen und lebendigen Dienst, der ihm innewohnt und über die nicht anerkannten, kreativen und innovativen Berufe, die ein indirektes – doch insgeheim direktes – Zeugnis ablegen von dem, der sich selber zum Diener gemacht hat.
Elio Jaillet
«Beten!» – Und: «Kanonen kaufen!»
Anders als 1914 beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs war Barth 1939 von der Notwendigkeit des Krieges überzeugt. Im März 1939 reagierte er in Dänemark auf eine Diskussion unter Pfarrern, wie man bei einer deutschen Besetzung mit der dann neuen ‹Obrigkeit› umzugehen habe, so: «Hitler ist keine Obrigkeit, der gehorcht werden soll. Er ist ein Tyrann, der bekämpft werden muss, auch für Euch!» Und: «Ich kann Ihnen kein Programm geben. Aber ich kann Ihnen den ersten Punkt sagen: Beten! Und den letzten: Kanonen kaufen!»
Unter der Situation gerade der deutschen Freunde und Schüler litt Barth natürlich trotz seiner klaren Haltung. Ende August 1939 nahmen einige an einem Ferienkurs in Walzenhausen teil. Man sprach unter anderem über das Recht zur Verweigerung des Kriegsdienstes, als sie aufgrund der Nachricht des Kriegsausbruchs vorzeitig und in eine ganz und gar ungewisse Zukunft aufbrechen mussten. Barth schrieb an seine Tochter: «Man denkt mit Kummer an die vielen lieben Menschen in Deutschland, die man kennt, an die Unzähligen in allen Ländern, die man nicht kennt, über die nun so viel Leid und Tod hereinbricht und schon hereingebrochen ist.»
Doch er blieb dabei: «Es hat wohl schon lange keinen Krieg mehr gegeben, in dem man jedenfalls auf der einen Seite so klar wusste, dass man Alles um einer guten Sache willen auf sich nahm und dass sich jedes Opfer lohnen werde.» Wenig später meldete Barth sich freiwillig zum Aktivdienst und bestand darauf, nicht in einer Schreibstube eingesetzt zu werden, sondern Dienst an der Waffe zu leisten.
Peter Zocher
Dämonen oder vielleicht doch nicht?
Die Welt ist voller Dämonen! Überall lauern finstere Mächte, die uns überkommen und uns zu Untaten verleiten wollen. Wie? Sie schütteln den Kopf? Zumindest gemäss Karl Barths Theologie ist die Welt voller Dämonen resp. «Herrenlosen Gewalten». Nur nennt er sie nicht Asasel und Nephilim, sondern Totalitarismus und Sportverrücktheit – manchmal auch gut biblisch Mammon (um nicht Kapitalismus zu sagen). Das Perfide ist, dass diese Mächte im Grundsatz gut wären. Sie sind menschliche Fähigkeiten, mit denen wir uns in der Wirklichkeit bewegen. Nur ist für Barth die Wirklichkeit von Gott gegeben. Wenn sich die Menschen von Gott lösen, beanspruchen ihre Fähigkeiten die Wirklichkeit für sich. Sie verselbständigen sich und dienen nicht mehr uns, sondern wir dienen ihnen. Auf einmal richten Parteien ihr Programm nicht mehr nach den Interessen ihrer Wähler aus, sondern gewinnen die Wähler für ihr Programm. Auf einmal geht es in der Wirtschaft nicht mehr um die Erhaltung von Menschleben durch Arbeitsplätze, sondern um die Erhaltung von Arbeitsplätzen durch den Einsatz von Menschenleben. Auf einmal dient Sport nicht mehr der Lebensqualität der Menschen, sondern ganze Wohnquartiere fallen dem Bau von Fussballstadien zum Opfer. Diese Dämonen bleiben unsere Fähigkeiten. Kein Dämon hat absolute Macht. Wir könnten den Lauf der Welt ändern. Darum sind wir als Christinnen und Christen aufgefordert, wachsam zu sein und kritisch unsere Stimme zu erheben, wenn immer Mächte nicht mehr den Menschen, sondern Menschen den Mächten dienen.
Raffael Sommerhalder
Karl Barth und das «Augusterlebnis»
Als Anfang August 1914 der Erste Weltkrieg ausbrach, wurden viele von einer nationalistischen Kriegsbe-geisterung erfasst, die man später «Augusterlebnis» nannte. Barth, damals junger Pfarrer in Safenwil, war entsetzt darüber, dass auch einige seiner akademischen Lehrer öffentlich für die deutsche Seite Partei ergriffen und den Krieg teilweise gar mit religiösen Legitimationen versahen. Selber predigte er am 2. August 1914 über
Mk 13,7 und sagte seiner Gemeinde: «Wieviel dumpfen, leidenschaftlichen Hass sehen wir jetzt auf einmal hervorlodern zwischen den Völkern [...]! [...]
Wie passt das zu der fortgeschrittenen Menschheit von heutzutage?» (Predigten 1914, 398) Er warnte davor, so zu reden, «als wäre der Krieg eine Naturerscheinung wie Sonne und Regen, unvermeidlich und unüberwindbar wie diese». Nein, «der Krieg ist unrecht, der Krieg ist Sünde, der Krieg ist keine Notwendigkeit, sondern er stammt nur aus dem Bösen der menschlichen Natur.» (403) Der Kriegsausbruch zerrüttete das Verhältnis Barths zur Generation seiner theologischen Lehrer – und liess dadurch ein neues, ernstes theologisches Fragen nötig werden.
Michael Pfenninger
Das war neu: Vor hundert Jahren hat Karl Barth pionierhaft beschrieben, warum Israel und Kirche zusammengehören: Beide haben dieselbe Offenbarung, dieselbe Hoffnung, dasselbe Gericht. Israel zeigt die unerfüllte und offene Situation des Menschen vor Gott. Die Kirche zeigt den erfüllten und versöhnten Menschen. Dadurch verdeutlicht Barth, dass der Mensch vor Gott im Übergang ist: von ‹alt› zu ‹neu›. (Barth will aber nicht etwa sagen, dass die Kirche näher bei Gott sei als Israel!)
Diese Israel-Theologie provoziert und weitet gleichzeitig den Horizont. Sie fordert nämlich von Theologie und Kirche, die reale und offene Geschichte der Menschen immer wieder neu ernst zu nehmen und sie vor Gott zu stellen. So muss z. B. gefragt werden: Was können wir uns heute von Gott erhoffen? Was dürfen wir tun, von dem, was wir können? Worauf läuft unsere Geschichte hinaus?
Israel provoziert auch heute. Gleichzeitig macht Barth immer noch Mut, die Steilpässe fröh-lich anzunehmen und den Ball vehement in Richtung Ziel zu schiessen. Sollte er dabei aber übers Ziel hinaus oder an ihm vorbei gehen: Auch das gehört zur Geschichte der Menschen.
Andreas Zingg
Dass Barth Mozart gleichsam zum Zeus des Musikhimmels erklärte, freut und erstaunt mich. Denn Mozart war ja auch Freimaurer. Zeigt sich darin Barths «wahre» Vorstellung von Allversöhnung, dass er sie nicht nur «nicht nicht» lehrte, sondern insgeheim eben doch? Das will ich ihn fragen, wenn ich einmal da bin, wo er wie Mozart schon ist. Und ob er seine «Kirchliche Dogmatik» als freie Romane, Erzählungen, Lyrik neu schrieb. Denn ihn faszinierte an Mozart ja, dass er mit seiner Musik nicht lehrt, sondern spielerisch be- und verzaubert. Schliesslich dies, ob er nun nur Mozart höre, der für ihn Freiheit in unüberbotene Musik umsetzte – weil deren «Geheimnis» sei, dass darin eine Bitte wie «Dona nobis pacem» «allem zum Trotz schon erfüllte Bitte» sei; oder inzwischen auch Bachs Johannespassion mit dem Choral «Durch dein Gefängnis, Gottes Sohn, muss uns die Freiheit kommen»; oder Beethovens Neunte, Debussys «Spiel der Wellen». Aber vielleicht spielen solche Fragen dann gar keine Rolle mehr …
Andreas Heieck
Ohne Karl Barth hätte ich es nicht gewagt, Pfarrer zu werden. Mir war im Studium die ständige Rede von der «religiösen Erfahrung» verleidet. Ich sah hier mehr und mehr den Menschen mit seinen Möglichkeiten in den Mittelpunkt gestellt und konnte diese Selbstverständlichkeit nicht teilen. Ich war drauf und dran, mein Theologiestudium aufzugeben. Da fiel mir Barths Vortrag von 1922 «vor die Füsse»: Das Wort Gottes als Aufgabe der Theologie. «Wir sollen als Theologen von Gott reden. Wir sind aber Menschen und können als solche nicht von Gott reden. Wir sollen Beides, unser Sollen und unser Nicht-Können, wissen und gerade damit Gott die Ehre geben.» Diese Worte waren für mich ein neuer Schlüssel und eine Befreiung. Hier wurde die Gottheit Gottes und die Menschlichkeit des Menschen in letzter Konsequenz ernstgenommen. Ich verstand, dass man nur Pfarrer werden kann unter Anerkennung dieses «unendlichen qualitativen Unterschieds» von Gott und Mensch. Und im Festhalten daran, dass sich Gott in seinem Sohn zur Welt bekennt. Das begründet die Zuneigung zu den Menschen, wer und wie sie auch seien. Es war mir eine Art «gratiam referre», u.a. diesen Vortrag, der für mich zum Schlüssel wurde, als Herausgeber in der Barth-Gesamtausgabe neu zugänglich zu machen.
Holger Finze-Michaelsen
Pfingsten
Im Jahr 1967 fragte Karl Barth den damals in Tübingen lehrenden Professor Ratzinger in einem Kolloquium über die Offenbarungskonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils, ob die römisch-katholische Kirche vielleicht Angst vor dem Heiligen Geist habe: „Warum spielt die Tradition, auch wenn sie jetzt neu verstanden ist, immer noch eine so tragende Rolle für die katholische Kirche? Kommt das etwa aus einer Angst vor dem Heiligen Geist? Lieber Herr Ratzinger, ich frage nur, und Sie werden sich das wohl auch selbst fragen, ist Ihre Kirche vielleicht aufgebaut auf der Flucht vor dem Heiligen Geist?“
Angesichts des beständigen Mühens um Selbsterhalt der institutionellen Kirche müsste man diese Frage über fünfzig Jahre später beiden Kirchen gleichermassen stellen, der katholischen wie der reformierten. Es stimmt wohl, „Charisma und Institution verhalten sich stets spröde zueinander“, und doch hat die Institution Kirche nur dann eine Berechtigung, wenn es darin nicht um sie selbst, sondern immer um den geht, der sie sendet (Jörg Lauster).
Das Gegenteil der Flucht vor dem Heiligen Geist wäre wohl das Vertrauen in seine gestalterische Kraft. Ob uns das irgendwann gelingt?
Melanie Pollmeier
Der rauchende Barth
Wer als Theologin im 21. Jahrhundert auch mal raucht, gibt sich als unzeitgemässe Zeitgenossin. Lernen lässt sich das vom rauchenden Kirchenvater des letzten Jahrhunderts: Karl Barth. In seiner Kirchlichen Dogmatik kam er denn nicht umhin, hinsichtlich der Anthropologien seiner Fachkollegen anzumerken, «dass keiner dieser Apologeten es für der Erwähnung würdig hielt, dass unter allen Wesen scheinbar nur der Mensch zu lachen und zu rauchen pflegt» (KD III/2, 96). Lachen und rauchen – das waren für Barth anthropologische differentia specifica. Barth hat zeitlebens geraucht, auch noch als er 1964 über die verheerenden gesundheitlichen Wirkungen in Kenntnis gesetzt wurde. Aber Barth ging eben nicht trotz, sondern wegen seiner hellwachen Zeitgenossenschaft nicht immer mit der Zeit. Und Fortschritt hielt er ohnehin für «ein aufs tiefste dubioser Begriff» (KD IV/1, 787). Anstatt von der Zeitgemässheit, die für die Modernität und damit für eine Theologie auf der sogenannten Höhe der jeweiligen Zeit steht, sprach Barth stets von der Zeitgenossenschaft, denn in der Theologie zähle nicht der Fortschritt, sondern die Reformation. Vor die Herausforderungen der Zeit gestellt, kann dies für den Theologen auch mal ganz schön unbequem werden. Etwa so unbequem, wie es heute ist, Raucher_in zu sein. Der rauchende Kirchenvater liess sich davon indes nicht irritieren, sondern bekannte: «Vor allem: in necessariis keinen Schritt nachgeben, in dubiis sich nichts merken lassen, in aliis die Pfeife nicht ausgehen lassen.» (Rundbrief 22. Januar 1922.)
Matthias Käser-Braun
Heute sind wir dauervernetzt und in ständigem Austausch mit unseren Freunden in den Social Media und Coworking Spaces. Karl Barth und Eduard Thurneysen hatten nicht einmal ein Telefon. Trotzdem pflegten sie ihre Freundschaft und Arbeitsgemeinschaft in einer Intensität, die uns staunen, ja neidisch werden lässt. Die über vierhundert Briefe, die sie sich allein in den Jahren 1913 – 1921, als Barth im aargauischen Safenwil und Thurneysen im 17 km entfernten Leutwil ihre jeweils erste Pfarrstelle inne hatten, schrieben, zeugen davon.
Die beiden Männer trafen sich regelmässig: nicht zum Biertrinken, sondern um einander Predigten vorzulesen, Unterrichtseinheiten vorzustellen oder um Ausschnitte aus Barths Römerbrief-Kommentar zu überarbeiten. Wenn Thurneysen morgens um 5 Uhr aufbrach, war er um 9 Uhr bei Barth. «Komm doch bald wieder herüber mit gutem Zuspruch. Ich lebe kärglich aus der Hand in den Mund, und niemand ruft hier Amen!», schreibt Barth zerknirscht am 18. Mai 1918 an Thurneysen. Im quasi ununterbrochenen Gespräch kam Barth auf Gedanken, fand Formulierungen und Stichworte, wie das berühmte «Gott – der ganz Andere», auf die er alleine nicht gestossen wäre.
Und man darf – wie Suzanne Selinger – mit guten Gründen vermuten, dass Charlotte von Kirschbaum später dieses Gegenüber im Gespräch ersetzt hat, ohne das Karl Barth niemals so unermüdlich und fokussiert hätte arbeiten können. Einen Menschen neben sich zu wissen, der «Ja» und «Amen» sagt und zwischendurch auch «Nein» – in Analogie zum göttlichen «Partner» – ist von immenser Bedeutung. Die dialektische Theologie ist zuerst und vor allem dialogische Theologie.
Andrea Anker
Heute ist Ostern
«Wer Karl Barth hören will, muss straffällig werden und ins Gefängnis gehen.» So hiess es in Basel zwischen 1954 und 1964. In dieser Zeit hielt Karl Barth Gottesdienste nur im dortigen Gefängnis. Zugleich besuchte er auch immer wieder die Gefangenen. Einmal nun wurde gemeinsam an Ostern der Gottesdienst gefeiert. Es fehlte aber einer. Barth kannte ihn gut und wusste, dass er immer wieder mal an Schwermut litt. Barth erkundigte sich, wo er denn sei. Er bekam von den Wärtern zur Antwort: «Der sitzt verbittert in seiner Zelle. Heute will er einfach keinen Gottesdienst.» Antwort von Barth: «Ich muss jetzt erst diesen Mann besuchen.» Der Gottesdienst konnte und musste eben solange warten. Barth ging zu der Zelle eben jenes Mannes. Der stand wohl traurig da. Da legte Barth den Arm um seine Schultern – mit den Worten: «Du Paule, hit isch d’Oschtere, do muesch nit truurig sy, chumm mit!» Und Paule… kam mit.
Bernhard Wintzer
Ein Brief vom Götti
Wenn man heute Konfirmand_innen fragt, was sie zur Konfirmation erhalten haben, hört man viele verschiedene Antworten: Uhren, Geld, …. Hauptsache: Geschenke. Nicht aber Fritz: Er hat einen Brief vom Götti erhalten. Einen Brief, der anfängt mit «Es geht nicht» und endet mit «Dein Herz sei Gott befohlen». Einen Brief, den ein berühmter Götti namens Karl Barth als Flugblatt in «einem Kreis zürcherischer Pfarrer» herausgegeben hat (ca. 1916). Aber auch einen Brief, der Zwingli, Palmsonntag und Konfirmation zusammendenkt. So erinnert sich der Götti an seine eigene Konfirmation am Palmsonntag und daran, was alle Konfirmanden erhalten: den Konf-Spruch der zugleich auch Gottes Zuspruch verdeutlichen soll. Denn: ein christliches Leben zu führen, ist nie weniger anspruchsvoll, als am Tag der Konfirmation oder eben am Tag des Einzuges Jesu in Jerusalem. Christ sein (oder wie Christus mit offenen Augen dem Kreuz entgegengehen) erfordert aber Mut. Und hier kommt Zwingli ins Spiel: «Tut um Gottes Willen etwas Tapferes!» und schon ist nicht mehr nur Fritz angeschrieben. Was steht in Ihrem Konf-Spruch?
Ariane Albisser
Augenblick
«Wem glaubst Du, mir oder deinen Augen?» fragt Graucho Marx in «Duck Soup» beleidigt seine Geliebte. Trotz der unverhohlenen Dreistigkeit, mit der der Ertappte seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen versucht, wirft sein Manöver die biblisch motivierte Frage auf: Sind auch diejenigen selig, die glauben, obwohl sie zwar nicht nicht, aber anderes sehen? Reformierte neigen zu dieser Sicht, weil sie dem Sehsinn traditionell kritisch gegenüberstehen. Dem wort-gewaltigen Zutexten des eigenen Blicks hat Karl Barth im Namen der Humanität energisch widersprochen: «Das ist nämlich der humane Sinn des Auges: dass der Mensch dem Menschen Auge in Auge sichtbar werde. […] Wenn der Eine dem Anderen wirklich in die Augen sieht, dann geschieht ja automatisch auch das, dass er sich vom Anderen in die Augen sehen lässt.»
(KD III/2, 299) Unser naturwissenschaftlich geschulter Blick durchschaut fast alles. Gleichzeitig vermeiden wir den Augenkontakt, weil er uns für andere durchschaubar macht. Die Scheu vor dem Augenblick macht unsere Welt unmenschlich.
Frank Mathwig
Humor trotz(t) Spassgesellschaft
Spätestens seit Max Webers Calvin-Fehldeutungen gelten Reformierte als echte Spassbremsen. Daran ändern auch die in dieser Jahreszeit üblichen Karnevalsanlässe nichts, die eigentlich das Highlight gelebter schweizerischer Ökumene bilden. Der «Karnevalshumor» ist für Karl Barth gerade ein Beispiel für «unechten […] Humor», weil er nur für einen Augenblick von den Mühsalen des Lebens ablenken soll. Theologisch geht es stattdessen um einen Humor im Angesicht des Ernsts der Lage: «Humor bedeutet […] ein gewisses letztes Nicht-Ernstnehmen der Gegenwart, nicht weil sie an sich nicht ernst genug wäre, aber weil die in die Gegenwart hineinreichende Zukunft Gottes noch ernster ist. Humor bedeutet eine grosse Einklammerung des Ernstes der Gegenwart.» (Ethik II, Zürich 1978, 445) Echter Humor macht sich über die eigene Ernsthaftigkeit lustig und gibt damit den Blick frei für die viel grössere Ernsthaftigkeit des sorgenden Gottes. Nicht wer zuletzt lacht, aber wer mit dem Schöpfer und Vollender des eigenen Lebens lachen kann, lacht am besten.
Frank Mathwig
Streiten ja – aber mit «vorletztem Ernst»
Karl Barths Hauptwerk heisst Kirchliche Dogmatik. Wohl deshalb stellen sich viele ihn als einen finsteren Dogmatiker vor, der immer Recht haben wollte. Das trifft nicht zu. In einem Radiointerview sagte er kurz vor seinem Tod, er sei so «liberal» gewesen, dass er auch die «alten Orthodoxen» gelesen «und dann auch manch Gutes bei ihnen gefunden habe». Er hatte keine Mühe, ungeniert den «Heiden» Konfuzius, den Juden Buber und den Atheisten Feuerbach mit Zustimmung zu zitieren, weil er auch von diesen Denkern lernte. In einem der letzten von ihm entworfenen Paragraphen seiner Dogmatik nannte er den Heiligen Geist den intimsten «Freund des gesunden Menschenverstandes». Besonders schön ist eine Äusserung aus der Zeit, als der deutsche Kirchenkampf auf dem Höhepunkt stand: «Und darum kann der Streit in der Theologie, auch der gute notwendige Streit, […] doch nur mit vorletztem und ja nicht mit absolutem Ernst und Zorn geführt werden. […] Wenn wir alles gesagt haben, was notwendig gesagt werden muss, wird auch das ‚‹Band des Friedens› (Eph. 4,3) sichtbar werden müssen […].»
Frank Jehle
Schwindelerregend
Berge sind relativ. Je höher sie sich erheben und je näher man ihnen kommt, desto riskanter werden sie. Auch Theologie ist relativ, abhängig von der Steilheit ihrer Thesen, wie weit sie sich vorwagt und welche Ansprüche sie erhebt. Karl Barths süffisante Bemerkung über seine Wahlheimat Göttingen, in der die Einheimischen «von ‹Bergen›, ‹Spitzen› und dergleichen reden […], was bei uns kaum ein ernsthafter Misthaufen heissen dürfte» (Karl Barth – Eduard Thurneysen, Briefwechsel II 1921–1930, Zürich 1974, 62) hat auch eine theologische Pointe. «Flachländer» wie der Greifswalder Theologe Erich Foerster vermuteten hinter der «schreck-lichen» Radikalität von Barths Theologie seine Herkunft als «Sohn der Schweizer Berge». Und der Angesprochene bestätigt: Dialektische Theologie ist «ein grauenerregendes Spiel für alle nicht Schwindelfreien». Hier zählt die alte Bergregel: «Auf diesem schmalen Felsengrat kann man nur gehen, nicht stehen, sonst fällt man herunter» (Vorträge und kleinere Arbeiten 1922–1925, Zürich 1990, 167). Anders als im sonstigen Leben gilt: Schwindel ist keine Krankheit, sondern das Wagnis, ohne das Theologie nicht zu haben ist.
Frank Mathwig
Barth und die Ökumene
Die Einheit der Kirche über nationale und konfessionelle Grenzen hinweg lag Barth am Herzen. In der Ökumene blieb er jedoch ein kritischer Gast. Als er 1935 zu einer Studentenkonferenz in Basel eingeladen wurde, bezeichnete er ökumenische Konferenzen als „christliche Zirkusse“ und fragte sich: „Was kommt eigentlich heraus bei dem vielen Zusammenlaufen? Wäre es nicht allmählich besser, Konferenzen nur noch zu veranstalten, wenn man wirklich etwas zusammenzutragen hat an wirklich brennenden Nöten, Fragen und Aufgaben, an gemeinsamen Einsichten und Ausblicken - und gar nicht mehr um der Konferenz als solcher willen?“ Die Ökumene, für die er sich engagierte, war nicht auf institutionelle und sichtbare Einheit fixiert. Er verstand sie als Bewegung der sich zu Jesus Christus bekennenden Kirchen. Diese müssten ihre bereits bestehende Einheit in Verbundenheit mit dem Volk Israel artikulieren und in und für die Welt bezeugen, was Gott in Jesus Christus getan hat und tut.
Martin Hirzel
Aus der Enge in die Weite
Als Karl Barth zu Neujahr 1962 eine Radioansprache hielt, hätte er allen Grund gehabt, den Rückzug ins Reduit religiöser und politischer Sicherheit anzutreten: Der Bau der Berliner Mauer und die Invasion in der Schweinebucht waren nur zwei der vielen Ereignisse, die 1961 die Menschen in Atem gehalten hatten.
Dieser Enge der Angst stellte er aber nicht geistliche Waffenrüstungen oder die weltliche Forderung nach mehr Panzern gegenüber. Barth nahm das herrschende Bedürfnis nach Sicherheit und Festungen dennoch ernst. Nämlich, indem er es vom Kopf auf die Füsse stellte. Und das Denken und Fühlen aus der Enge in die Weite führte:
«Fest sind die Herzen von Menschen, die heute nicht hassen, wo die meisten hassen, sondern lieben, wo nur wenige lieben. Fest sind die Herzen von Menschen, denen Geben seliger ist als Nehmen, denen Brot für die Brüder bereitzustellen heute wichtiger erscheint als [...] nach neuen, noch schrecklicheren Waffen zu greifen. Fest sind die Herzen von Menschen, die darauf vertrauen, dass auch alles das, was vermöge unserer menschlichen Torheit [...] noch geschehen mag, in der festen Hand des gnädigen Gottes seine Grenze und sein Ziel hat. Die festen Herzen solcher Menschen werden auch im Jahr 1962, was es uns auch bringe, sie werden in Ewigkeit standhalten.»
Dominik von Allmen
Unter dieser Rubrik werden Sie das ganze Jahr hindurch im 14-tägigen Rhythmus kurze, knappe und prägnante Texte von, zu oder über den Jubilar finden. Sie werden in kürzester Form Lust auf Barth machen, Aspekte von Werk und Person antönen, Bedenkenswertes und Provokantes in den Raum stellen oder dem Lesepublikum ein Schmunzeln oder Lachen entlocken. Karl Barth wird damit einem allgemeinen Publikum als spannender, aktuell gebliebener Theologe und Mensch vorgestellt – Vorwissen braucht es keines.